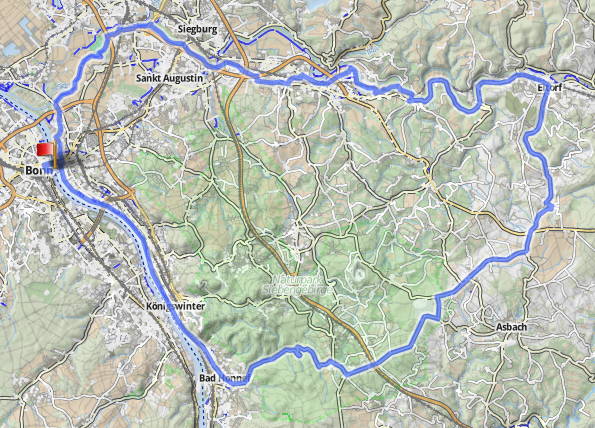|
| Rhöndorf, Kapelle |
Manchmal bin ich träge, wenn ich meine Touren
auswähle. Ich greife auf Touren zurück, die ich kenne und die ich häufig
gefahren bin. Und die landschaftlich so schön sind, dass sie mich jedes Mal
aufs neue überwältigen. Die Streckenführung kenne ich wie im Schlaf, auf jeder
Tour entdecke ich neue Details. Die Eindrücke bleiben haften und sind so
frisch, als hätte ich mich neu verliebt. Die Tour nach Eitorf ist eine solche
Tour. Zudem bietet sie einen weiteren
Vorzug: sie entspricht ziemlich genau meinem Leistungsvermögen. Achtzig
Kilometer gehen an meine Leistungsgrenze, dazwischen eine Pause in Eitorf. Und
auf der zweiten Hälfte, in der die Anstiege im Siegtal zahm sind, werden meine
Beine schwer.
Doch zunächst muss ich das Rheintal verlassen und die
Höhenzüge des Siebengebirges hinauf steigen. Alter Zoll, über die Kennedybrücke
nach Beuel, den Radweg immer den Rhein entlang, Königswinter, in Rhöndorf halte
ich mich links zur Hauptstraße, dann rechts, geradewegs nach Bad Honnef, wo
mich die protzige Villen am Straßenrand entzücken, am Kurviertel vorbei, an der
Fußgängerzone vorbei, dann links. Geradeaus folge ich der Beschilderung nach
Aegidienberg, hinter dem Ortsausgangsschild und dem Sportplatz zieht die
Steigung an. 5,8 Kilometer kurvenreiche Strecke liegen vor mir, dies verspricht
das Straßenschild. Das Versprechen ist voller Spannung. Aus einer zugewucherten
alten Fabrik ragt ein Schornstein heraus, Graffitis leuchten in prallem Blau
auf einer Verteilstation der Stadtwerke Bad Honnef, das Jagdhaus Schmelztal
unterstreicht seine Bedeutung mit einem Hirschgeweih an der Fensterfront. Die
5,8 Kilometer kurvenreiche Strecke rauschen wie im Traum vorbei, ich trete im
mittleren Gang, der Anstieg ist nicht allzu bissig, so dass ich meine Kräfte
einteilen kann. Hinter einer Kurve mit einem Wanderparkplatz zieht der Anstieg
auf seinem letzten Stück an, der Wald geht in Wiesen über, die ersten Häuser
von Aegidienberg rücken in Sichtweite.
 |
| 5,8 Kilometer kurvenreiche Strecke |
Aegidienberg ist einzigartig, was die Logistik des
Rennradfahrens betrifft. Am Kreisverkehr, in Ortsrandlage, befindet sich
nämlich ein Fahrradgeschäft, das reichlich Rennräder anbietet. Schlauch,
Mantel, Werkzeug, gerne habe ich mich dort mit allem nützlichen versorgt, um
Pannen gewappnet zu sein.
Am Kreisverkehr halte ich mich rechts, ich trete
gemächlich, aber es geht immer noch den Berg hinauf. An der nächsten großen
Ampel biege ich nach links ab, ich folge der großen Welle des Autoverkehrs, der
auf die Autobahnauffahrt der A3 zustrebt. Ein, zwei, drei Kreisverkehre reihen
sich in Rottbitze aneinander. Discounter und Handwerksbetriebe zerstreuen sich
am Waldrand. Nachdem der Troß der Autofahrer auf die Autobahn eingebogen ist, folge
ich der Straße geradeaus und kann ich in aller Ruhe genießen, wie es bergab
geht. Zufrieden schaue ich nach vorne, wie sich der gerade Strich der Straße
nach unten zieht. Großzügig breitet sich ein Streifen von Gras am Straßenrand
aus, dahinter stemmt sich all die Wucht des Mischwaldes in die Höhe.
Nachdem ich die Landesgrenze zu Rheinland-Pfalz
überquert habe, öffnet sich das Gelände. Ich bin in der Musser Heide angelangt.
Ich biege nach links ab Richtung Buchholz und ich bin entzückt, welch ein
großer Blütenteppich auf der Wiese blüht, eine Sinfonie in Farben. Und es ist
merkwürdig, dass dieses Farbenmeer gar nicht weit weg von einem Flugplatz liegt,
der sanft eingebettet ist zwischen Siebengebirge und Westerwald. Den Flugplatz
sind die Nationalsozialisten schuld. Fluglärm brauche ich keinen zu fürchten,
denn lautlos betreiben Segelflieger dort ihren Freizeitsport.
 |
| Musser Heide |
„Muss“ leitet sich von „Moss“ ab, was so viel wie
Moor bedeutet. Davon bin ich nicht weit entfernt, denn auf der Asbacher
Hochfläche breitet sich tatsächlich das Natuschutzgebiet „Buchholzer Moor“ as. Das
Gelände, nass, landwirtschaftlich nicht nutzbar, nur Fichten, Kiefern oder
Heide können dort wachsen, bebauten die Nationalsozialisten 1935, oder vielmehr
das Luftgaukommando in Köln. Der Flughafen hatte die Besonderheit, dass er vom
Feind nicht erkannt werden sollte. So wurde ein Wohnhaus, ein Geräteschuppen
und eine Scheune auf dem Flugplatz stehen gelassen. Sogar Vieh wurde in einem
Stall gehalten, während die Hangars den Formen der Scheune angepaßt wurden.
Sorgfältig ging man auch mit einer Kapelle um, die abgetragen wurde und jenseits
der Landstraße wieder aufgebaut wurde. Nach Kriegsende ging ein Teil des Flughafens
in den Besitz der Bundeswehr über, die hinter dem Segelflugplatz
Munitionsdepots unterhält.
An der nächsten Querstraße halte ich mich weiter in
Richtung Buchholz und biege nach rechts ab. Seicht rolle ich den Berg hinunter,
während sich Buchholz mit dem markanten weißen Kirchturm nähert. Pfusch am Bau
wurde betrieben, als die Kirche 1862 gebaut wurde. Der Sand aus den Sandgruben
bei Buchholz enthielt Salpeter, so dass der Mörtel mit der Zeit zerbröselte und
die Kirche einzustürzen drohte. Es führte kein Weg daran vorbei, dass die
Kirche abgerissen werden musste. Dem neuen Kirchtrum, der 1971 gebaut wurde,
sieht man sein junges Alter nicht an. Ich hätte ihn glatt in das Mittelalter
eingeordnet.
 |
| Kirchturm in Buchholz |
Hinter Buchholz geht es mal rauf, mal runter, aber
alles in Maßen. Wallroth und Oberscheid heißen die nächsten Dörfer. Die Höhen
des Westerwaldes waren stets dünn besiedelt, das war schon bei den Römern so.
Auf der rechten Rheinseite hausten die wilden Germanen, und diese mussten sich
die Römer vom Leib halten. Daher waren die Höhen des Westerwaldes eine Art
Pufferzone, in der sie alle Ansiedlungen gnadenlos nieder brannten, die ihnen
in den Weg kamen. Umgekehrt versuchten sie, die germanischen Stämme für sich zu
gewinnen und in ihren Römerstädten anzusiedeln. Die Römer gingen, die Franken
kamen. Diese bauten ihre Behausungen in den fruchtbaren Tälern der Pleis, Sieg
oder Wied, aber nicht hier auf der Höhe. Hinter Oberscheid besticht der
Fernblick in seiner Klarheit und ich schaue vorläufig ein letztes Mal auf das
Siebengebirge zurück.
Ich kreuze die Bundesstraße B8, die früher als
Handels-, Heer- und Poststraße quer durch den Westerwald bis nach Leipzig
führte. Nicht weit von dieser Kreuzung wurde eine der größeren Schlachten des
Rheinlandes geschlagen, die 1796 als „Schlacht von Kircheib“ bekannt wurde,
kaum Eingang in die Geschichtsbücher fand, aber dafür um so blutiger endete. Im
Zuge der französischen Revolution verlangten Preußen und Österreich von
Frankreich, dass der abgedankte Sonnenkönig Ludwig XIV. wieder als
Alleinherrscher eingesetzt werden sollte. Preußische und österreichische
Truppen griffen Frankreich an, als die Regierenden dies ablehnten. Daraufhin
schlugen französische Truppen zurück, sie drangen ins Rheinland ein, sogar bis
auf die rechtsrheinische Seite. Nahe der B8 richteten die Franzosen ein
Feldlager für 20.000 Soldaten ein, das sie mit Schutzwällen und Schützengräben
befestigten. Im Morgengrauen des 19.
Juni 1796 kam es zu ersten Gefechten, als österreichische Truppen, die mit 14.000
Soldaten weit unterlegen waren, das französische Lager angriffen. Die
Österreicher sollten dennoch die Franzosen eine vernichtende Niederlage
beibringen, weil ein Späher die Stärke des österreichischen Heeres falsch
einschätzte. Er meldete seinem Brigadegeneral 35.000 österreichische Soldaten,
die das Lager von beiden Richtungen der Heerstraße umgaben. Der Brigadegeneral
kommandierte daher nur die Hälfte seiner Soldaten auf die Höhen von Kircheib,
wo die Österreicher sie auf dem karg bewachsenen Gelände zuerst mit Kanonen
beschossen und dann mit ihren Bajonetten aufspießten. 2.500 französische
Soldaten wurden getötet, aber nur 500 österreichische.
 |
| letzter Blick auf das Siebengebirge im Hintergrund |
Hinter der Kreuzung kann ich meine Beine baumeln
lassen, denn bis Eitorf kann ich zehn Kilometer mitreißende Abfahrt genießen.
Ich bin überwältigt, wie die Straße sich windet, biegt, krümmt, Schlangenlinien
zieht, die Undurchdringlichkeit des Waldes aufreisst. Ich radele vorbei an
sonnenbeschienen Wiesen, dem glucksenden Eip-Bach und Tannen, die in den Himmel
ragen. Meine Glücksgefühle nehmen kein Ende, bis ich den Ortseingang von Eitorf
erreiche. Der Kraftaufwand ist mäßig, ich muss wieder in die Pedale treten, ich
fahre in Eitorf hinein über die Asbacher Straße. Graue Mietskasernen am
Waldrand sind so platt, dass sie mich an Bauten in der früheren DDR erinnern. Fassaden
aus rostbraunen Ziegelsteinen bröckeln. Ich rumpele an einer Baustelle vorbei.
Beschaulichkeit sieht anders aus.
Der Marktplatz im 1960er-Jahre Stil gehört nicht
gerade zu den Top-Sehenswürdigkeiten, doch ich habe mich an Eitorf gewöhnt,
vielleicht, weil es nicht abgedreht ist und authentisch wirkt. An dem Rathaus,
einem phantasielosen Zweckbau, ist die Fensterfront so grau wie die
heruntergelassenen Jalousien. Auf dem Marktplatz muss ich mich an parkenden,
suchenden und herumkurvenden Autos vorbei wursteln. Zu Fußball-WM-Zeiten
gelingt es der einen oder anderen Deutschland-Fahne, die Häuserfronten aus der
Umklammerung der Eintönigkeit zu befreien.
Die Ruinen des Marktplatzes haben die Eitorfer in
einem schwarzen Viereck verewigt. Das sind schwarze Pflastersteine, deren
Formen ein Viereck zeichnet, das wiederum an die Umrisse des einstigen
Kirchturms erinnert. 1144 wurde die „villa Eythorp“ in einer Urkunde des
Stiftes Bonn-Vilich erstmals erwähnt, fast zeitgleich wurde um 1150 wurde die
romanische Kirche fertiggestellt. Dreißigjähriger Krieg, Pfälzischer
Erbfolgekrieg, Spanischer Erbfolgekrieg, Siebenjähriger Krieg, bis in das 18.
Jahrhundert hinein waren große Teile des Rheinlandes wie ausgemergelt,
ausgelaugt und verödet. Hinzu kam, dass Eitorf inzwischen zum Herzogtum Berg
gehörte, welches von Düsseldorf aus regiert wurde. Weit entfernt von der
Hauptstadt, schwand das Interesse der Herzöge. So kam es, dass zwar Handwerker
aus Eitorf die Wände des Mittelschiffes neu vermauerten. Die Regierung in
Düsseldorf zahlte ihnen aber keinen Lohn, weil sie ihre eigenen Architekten
hatte, und diese suchten sich wiederum ihre eigenen Handwerker aus.
So verfiel die Kirche und wurde schließlich so baufällig,
dass sie nicht mehr benutzt werden konnte. 1889 wurde ein Neubau südlich des
Marktplatzes beschlossen. Beim Bau der neuen Kirche wurde das Kirchenschiff der
romanischen Kirche abgetragen, während der Turm stehen blieb. Dieser behauptete
seine Stellung, ohne einzustürzen. Das
blieb so bis zu den Geschehnissen des 17. März 1945.
 |
| Eitorf - Rathaus (oben) und Marktplatz (unten) |
Eitorf hatte es in seinen letzten Wochen des Zweiten
Weltkriegs übel erwischt. Die militärische Lage war hoffnungslos. Am 7. März 1945
hatten die Alliierten bei Remagen den Rhein überschritten. Truppen und Panzer
wälzten sich durch das Siegtal voran, zum Durchmarsch nach Westfalen. Das Ende
kam mit Schrecken, denn die militärischen Befehlshaber richteten ihren Terror
nun gegen die eigene Bevölkerung. So befahl Himmler Ende März 1945, alle
männlichen Einwohner in Häusern zu erschießen, die dem Feind eine weiße Fahne
zeigten. Der Oberbefehlshaber West im Rheinland, Walter Model, konkretisierte
diesen Befehl: „Alle, die abseits
ihrer Einheit auf Straßen, in Ortschaften, in Trossen oder Ziviltrecks, auf
Verbandsplätzen, ohne verwundet zu sein, grundlos angetroffen werden und
angeben, noch versprengt zu sein und ihre Einheit zu suchen, sind standrechtlich
abzuurteilen und zu erschießen". Selbst in dieser aussichtslosen Lage
teilte er dem Führer mit: „Der Sieg der nationalsozialistischen Idee steht
außer Zweifel, die Entscheidung liegt in unserer Hand.“
Diese Botschaft hatte
Wurzeln geschlagen und war im Siegtal angekommen. Bei Merten und Eitorf hatten
sich Widerstandsnester „deutscher Ritterkreuzträger“ gebildet, die den Glauben
an den Nationalsozialismus hochhielten und bis zur letzten Patrone kämpften.
Diese letzten Widerstandskämpfer schafften es, dass die Schlacht um Eitorf sich
achtzehn Tage lang in die Länge zog – sie begann am 21. März und endete am 7.
April. Zweimal wurde Eitorf bombardiert, darüber hinaus lag sie unter Dauerbeschuss
von schwerem Artilleriefeuer, unterstützt von Jagdbombern. Erst nach zähen
Häuserkämpfen eroberten die Alliierten die Stadt. Während des Luftangriffs
versank der alte Kirchtum am 17. März 1945 in Schutt und Asche, so wie der
Marktplatz und weite Teile der Stadt. In der Nachkriegszeit beschlossen die
Verantwortlichen der Stadt, den Turm nicht wieder aufzubauen und ihn in den
schwarzen Viereck zu verewigen.
 |
| Pause an der Imbissbude |
Da die einzige
Gaststätte am Marktplatz mit Außengastronomie um die Nachmittagszeit geschlossen
ist, muss ich mich noch ein Weilchen abstrampeln. An der nächsten großen
Kreuzung biege ich links ab, ich folge dem Hinweisschildern in Richtung Hennef.
Nach einem Kilometer ist es soweit, denn ich mache am Straßenrand Pause. Die
beiden Flaschen Pils, die ich in einem Imbiss trinke, vollbringen eine Wohltat,
denn sie sind erfrischend kühl. Geruhsam lasse ich den Straßenverkehr vorbei
rauschen. Ich schaue die Anhöhe hinauf, die ich bald hoch schleichen werde.
Man könnte fragen,
wieso ich mir die Landstraße L333 durch das Siegtal antue. Auto drückt sich an
Auto, Stoßstange an Stoßstange. Glücklicherweise ist die Richtung Hennef
deutlich weniger frequentiert wie diejenige Richtung Eitorf. Anfangs war es ein
Stück Bequemlichkeit, weil ich immer nur geradeaus fahren wollte. Nun sind es
die Kurven und Schleifen, die die Sieg zieht und denen die Landstraße folgt.
Vor allem sind es diejenigen Abschnitte – bei Merten und hinter Bülgenauel – an
denen die Straße zwischen der Sieg und den Felswänden regelrecht eingequetscht
wird. Ruhig, seicht und glatt, schimmert die Wasseroberfläche der Sieg zwischen
Buschwerk hindurch. In schmalen Ritzen fällt das Sonnenlicht auf die Straße, während die Felswände senkrecht auf der
anderen Seite empor steigen und auf deren Spitze hartnäckiges Strauchwerk die
Stellung hält. Und bei Bülgenauel traue ich kaum meinen Augen, wie der schroffe
Felsen von einer Burgruine gekrönt wird: das ist Blankenberg, in seiner
Wortentstehung hieß der Flecken „auf dem blanckenberge“, dies bestätigte
jedenfalls der Kölner Erzbsichof Philipp von Heinsberg 1171. Ich schaue aus dem
Tal auf die in luftiger Höhe hängende Ruine, die schwindet, je mehr die Straße
auf die Felspartie zuläuft.
 |
| Felsen auf der Landstraße L333 |
Ich wundere mich,
dass all die Rheinromantiker und Literaten es im 19. Jahrhundert bis an die Ahr
und in die Eifel geschafft haben, aber kaum ins Siegtal. Die spröde Schönheit
beeindruckt, die harten Konturen des Geländes reißen mit. Die Ruhe, die das
gemächliche Flußbett der Sieg vermittelt, steht der Schönheit der Flußtäler auf
der anderen Seite des Rheins um nichts nach.
Man könnte das
Siegtal als Geheimtipp bezeichnen. Ferdinand Freiligrath oder Karl Simrock, Clemens
Brentano oder Gottfried Kinkel, all diese Rheinromantiker, die von Burg zu Burg
wanderten, schafften es nicht vom Rhein an die Sieg. Ernst Moritz Arndt, der
den Rhein, das Ahrtal und die Eifel in- und auswendig gekannt haben muss, widmet in seinen Wanderungen gerade eine
schlappe Seite der Sieg: „Die Gegend an der Sieg ist überhaupt merkwürdig
genug, zuerst durch ihre vortrefflichen Wiesenbewässerungsanstalten, und weil
ihre Berge den besten Stahl Deutschlands liefern.“
Stahl ? Hüttenwerke
liegen an der anderen Ecke der Sieg, bei Siegen, und anstatt dessen betrete ich
Neuland. Ich teste den Siegtalradweg. Im Siegtal rühren die verantwortlichen
Tourimus-Manager fleißig die Werbetrommel. Die Anzahl der Übernachtungen steigt.
Wanderer locken sie mit dem Natursteig Sieg. Von Windeck bis zur Mündung in den
Rhein begleitet ein durchgängiger Radweg die Sieg. Am ersten Sonntag im Juli
geht dann das große Event für Fahrradfahrer los – „autofreies Siegtal“. Ich war
nie da, vor allem die S-Bahn-Züge müssen vollgestopft sein mit Fahrradfahrern,
haben Freunde uns erzählt.
 |
| die Sieg - einfach schön |
Ich mag es ruhiger,
so wie heute, und an den ersten Häusern von Hennef-Stein folge ich dem
Fahrradsymbol des Siegtalradweges, nach wenigen Metern biege ich wieder links
ab. Ich bin gelandet in der Abgeschiedenheit von Feldern. Anfangs gleitet der
Fahrradweg auf einem gut befestigten Schotterweg dahin, der nach der nächsten
Querstraße auf einen Teerweg wechselt.
Ich bin nicht immer
ein Freund von Radwegen entlang von Flüssen, weil sie manchmal in Zickzack-Form
verlaufen, Umwege produzieren, am Wochenende bei schönem Wetter zu stark
frequentiert sind oder auch an manchen Stellen als Feldweg für Rennradfahrer ungeeignet
sind. Hier an der Sieg läßt es sich gut aushalten. Ich halte Blickkontakt mit
dem Fluß, der sich durch sein Bett windet, träge und mit einem Schuß
Leichtigkeit. Ich lasse mich tragen von der Stimmung, bemerke am Rande, dass
das Tal breiter wird, während Kleckse von Häufchenwolken den Sonnenschein nicht
trüben. Und beiläufig bemerke ich ein anderes Hindernis: zwischen den flach
auslaufenden Mittelgebirgsrändern weht der Wind zwar nicht stramm, aber unentwegt
aus Nordwest. Ich spüre ihn, wie er sich meinem Körper entgegen stellt. Einige
Reserven muss ich aus meinen Beinen heraus holen, meine Tritte werden
schwerfällig. Ich radele durch bis zum Ziel, das beschließe ich.
Hinter Weldergoven
biege ich ab, ich fahre quer durch Hennef, die Frankfurter Straße entlang, dann
nach Geistingen, am Kreisverkehr rechts, an der Ampel vor der
Mundorf-Tankstelle links, immer geradeaus bis zum Ortsausgangsschild, vorbei an
der Bauschuttdeponie in Niederpleis, in Stoßdorf folge ich der
Fahrradbeschilderung zurück an die Sieg, in Friedrich-Wilhelms-Hütte wechsele
ich über die Brücke auf die andere Seite der Sieg, weiter die Sieg entlang bis
zur Autobahnauffahrt Bonn-Beuel, nach Schwarz-Rheindorf, wieder zurück zum
Alten Zoll.
Strecke (84 km):
Höhenprofil:
Link nach www.gpsies.com